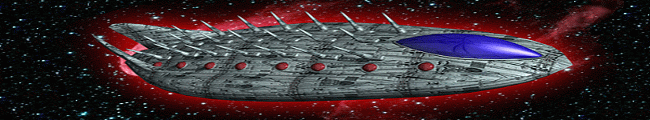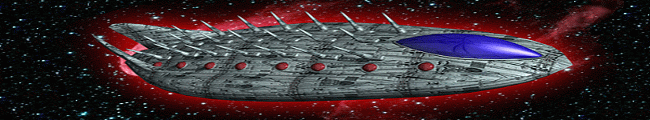Das Wissenschaftler-Ehepaar Roger und Elaine Newton arbeitet
zusammen mit seinem Kollegen Simon Wright, der nur noch als Gehirn in einem lebenserhaltenden Behälter existiert, weil es von
seinem todkranken Körper getrennt werden musste, an künstlichem Leben. Sie erschaffen den Roboter Grag und den Androiden Otho,
der seine Körperform ändern kann. Nach der Geburt ihres Sohnes Curtis werden die Eltern von einem Verbrecher ermordet. Der
kleine Curt wird von Simon, Grag und Otho aufgezogen und ausgebildet. Als Erwachsener nimmt er den Tarnnamen "Captain Future"
an und widmet sich mit seinen drei Freunden dem Kampf gegen das Verbrechen, der Ver- teidigung der Menschheit gegen außerirdische
Invasoren und der Erforschung des Universums in seinem Raumschiff COMET. Dabei kämpft er gegen einen selbst ernannten
Weltraumherrscher, rettet die Erde vor einem riesigen Planeten, der auf sie zu stürzen droht, sichert die Produktion des
unverzichtbaren Treibstoffes Gravium für die Raumschiffe, lüftet das Geheimnis der sieben Weltraumsteine und reist in die
ferne Vergangenheit, um die Bevölkerung eines dem Untergang geweihten Planeten zu retten. Er macht sich sogar auf die Spur
der Materiequellen, die ein be- rühmter deutscher SF-Serienheld Jahre später wieder aufnimmt, und
kehrt schließlich sogar vom Ursprüng der Schöpfung zurück.
Captain Future wurde in den USA ab 1940 ein eigenes Magazin gewidmet, in dem ein Roman um den Helden den Hauptteil der Seiten
belegte, ergänzt um Hintergrundmaterial und die eine oder andere vom Captain Future-Universum unabhängige Kurzgeschichte. Von
diesem Magazin kamen siebzehn Folgen heraus, bis es 1944 wie viele andere Magazine als Folge der Papierknappheit während des
Zweiten Weltkrieges das Erscheinen einstellen musste. Drei weitere Romane erschienen anschließend im Schwestermagazin Startling
Stories, das vom gleichen Verlag wie Captain Future herausgegeben wurde. Dann war für einige Jahre Schluss, bevor 1950/51
ebenfalls in Startling Stories noch weitere sieben kürzere Erzählungen herauskamen.
Interessant für deutsche Fans ist, dass es Ende der sechziger Jahre in den USA eine dreizehnbändige Taschenbuchausgabe der Serie
gab, für die neun Titelbilder des Perry Rhodan-Zeichners Johnny Bruck angekauft wurden. Diese Bilder waren vorher bereits auf
deutschen Perry Rhodan- bzw. Terra-Ausgaben zu sehen. Darunter ist auch das großartige Titelbild von Perry Rhodan 200, deswegen
kann man auf einem amerikanischen Captain Future-Roman einen Haluter bestaunen. Die Captain Future-Serie kann man in mancher
Hinsicht auch als Vorbild für Perry Rhodan sehen. Sie ist möglicherweise die erste Serie mit einem Weltraumhelden, die von
mehreren Autoren geschrieben wurde. Auch viele Themen der Serie wurden in Perry Rhodan wieder aufgegriffen, beispielsweise
die erwähnten Materiequellen. K.H. Scheer war sicher nicht von Captain Future beeinflusst, denn er las keine amerikanische SF.
Clark Darlton dagegen könnte diese Serie gekannt und die eine oder andere Anregung mitgenommen haben.
In deutschen Landen wurde der Weltraumheld bekannt, als er 1961/62 immerhin vierzehn Abenteuer in Utopia-Heften, holprig
eingedeutscht als "Captain Zukunft", erleben durfte. Es wurde eine Auswahl aus den zwanzig amerikanischen Romanen getroffen,
die in wild durcheinander gewürfelter Reihenfolge erschienen. Zuerst kamen sechs Titel in der Reihe Utopia-Großband. Das hatte
den Vorteil, dass die Originaltexte in dieser Reihe, deren Titel immerhin 96 Textseiten umfassten, kaum gekürzt werden mussten.
Weitere acht Romane erschienen anschließend gekürzt als Utopia Zukunftsroman mit nur 68 Seiten,
wie bei den meisten Heftromanen üblich.
Einen gewaltigen Popularitätsschub erfuhr Captain Future, als sich in den Siebzigern die japa- nische Filmindustrie des für
Kinder geradezu prädestinierten Stoffs annahm und auf Basis von 13 der Romane eine 52-teilige Anime-Zeichentrickserie für
das Fernsehen herausbrachte. In der deutschen Synchronisation wurde diese leider auf 40 Folgen zusammengeschnitten und die
Rei- henfolge der Ausstrahlung verändert. Wie bei Verfilmungen von literarischen Vorlagen üblich gab es zum Teil deutliche
Änderungen in der Handlung. Es wurden auch etliche Namen von Haupt- personen umbenannt, so wurde z.B. Curts Verehrerin Joan
Randall auf Joan Landor umgetauft.
Der Erfolg der Zeichentrickserie machte die Buchbranche erneut auf den Weltraumhelden auf- merksam. Im Bastei-Verlag erschien
neben einer auf den Animes aufbauenden Comicserie 1981-1984 eine deutsche Taschenbuchausgabe mit fünfzehn ungekürzten Romanen
in der Rei- henfolge der Originalserie. Nach dieser Ausgabe war dann lange Pause.
Erst 2011 ging es in Deutschland mit Captain Future weiter, als im Golkonda-Verlag in Berlin die bisher hierzulande unpublizierten
sieben kürzeren Erzählungen dem Publikum in zwei Sammelbänden vorgestellt wurden. Im zweiten Band wurde als Draufgabe noch die
bitterböse Erzählung Der Tod von Captain Future von Allen Steele aufgenommen, die für das Buch titel- gebend ist und gleichzeitig
als Hommage wie als Persiflage dient. Die Hauptfigur, ein Antiheld, der als Raumschiffkapitän seine Mannschaft drangsaliert, selbst
Fan der Serie ist und sich von seiner Besatzung als Captain Future ansprechen lässt, wird posthum unverdient als Retter gefeiert.
Anschließend an die beiden Sammelbände entschloss man sich bei Golkonda, die gesamte Reihe in ungekürzten neu übersetzten Ausgaben
samt Begleitmaterial mit den Titelbildern der amerikanischen Erstausgaben beginnend mit Band 1 herauszubringen. Diese Edition ist
2019 bei Band 8 angelangt, für Herbst ist Band 9 angekündigt. Zusätzlich erschien ein neuer Roman von Allan Stelle, der durch
den Erfolg seiner Erzählung, die mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde, zum Schreiben eines weiteren Abenteuers mit Curt und
seinen Freunden ermutigt wurde. Die Rache von Captain Future (Avengers of the Moon) greift weit in die Vergan- genheit zurück und
schildert, wie aus dem Waisenkind Curt Newton der Weltraumheld Captain Future wird.
Edmond Hamilton (1904-1977), der Hauptautor von Captain Future, war von Kind auf selbst von SF begeistert und konnte bereits als
Zweiundzwanzigjähriger seine erste publizierte Erzählung in den Händen halten. Gemeinsam mit seinen Kollegen Edward E. Smith,
John W. Campbell und Jack Williamson gilt er als einer der Hauptautoren der Space Opera in der frühen SF-Geschichte. Mit seiner
Serie über die Interstellar Patrol erwarb er sich einen Ruf als Weltenretter und Weltenzerstörer. Hamiltons
berühmtestes Werk ist The Star Kings, auf Deutsch mehrfach unter dem Titel Herrscher im Weltenraum und
später als Die Sternenkönige erschienen, ein gewaltiges Weltraumepos, das 200.000 Jahre an Zeitreise und viele Tausende von
Lichtjahren kosmischer Distanz umspannt.
Hamilton war nicht der Erfinder des Captain Future-Universums, aber er hat die Idee, die ihm vorgelegt wurde, zum finalen Konzept
weiterentwickelt und als Hauptautor zum Erfolg gebracht. Unter seinem Namen schrieb er die ersten dreizehn Romane sowie Band 19
und die später erschienenen Erzählungen. Von Nr. 14 bis 18 erschienen die Romane unter dem Autorennamen Brett Sterling, der
allerdings ein Pseudonym war, unter dem drei Romane von Hamilton und zwei seines Kollegen Joseph Samachson herauskamen. Einen
weiteren Roman steuerte Manly Wade Wellman bei. Dann gibt es noch die Erzählung und The Death of Captain Future
von Allen Steele, die aber nur am Rand zum Captain Future-Universum gehört, sowie Avengers of the Moon des
gleichen Autors. |