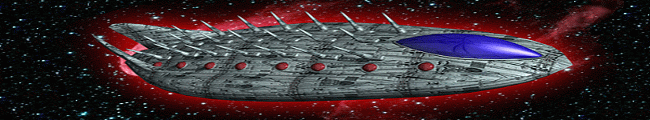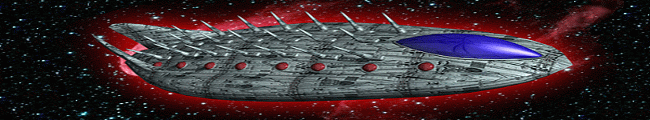Nach einigen kurzlebigen Heftreihen und -serien in
verschiedenen deutschen und österreichischen Verlagen kam 1953 im Rastatter Erich Pabel Verlag als erstes der beiden
Schwergewichte der deutschen SF-Heft- reihenkomplexe Utopia auf den Markt. Bis zur Einstellung der Reihe 1968 erschienen
596 Hefte, am An- fang vierzehntäglich, ab 1958 wöchentlich, mit einem Intermezzo 1964, als die Reihe auch nur
zwei- wöchentlich erschien.
Alle Ausgaben bis zur Nr. 43 waren ausschließlich Abenteuer der Serie Jim Parkers Abenteuer im Weltraum. Ab Nr. 44 kamen
auch serienunabhängige Romane heraus, die im Untertitel unter dem Utopia-Logo "SCIENCE FICTION Zukunftsroman" stehen hatten
und bald dominieren sollten. Der erste übersetzte Ro- man war als Nr. 53 Die gläserne Stadt von Noel Loomis. Nach Jim Parker
waren Mark Powers und Ad Astra sowie die aus dem Amerikanischen übersetzten Captain Zukunft-Romane, die großteils von Edmond
Hamilton verfasst wurden, bedeutende Subserien in Utopia.
Betrachtet man die gesamte Reihe, waren die im Original deutschsprachigen Titel gegenüber den übersetzten mit etwa 60 % in
der Überzahl. Bis inklusive Nr. 113 hatten die Hefte 48 Seiten (ohne die Umschlagseiten gerechnet), dann wurde auf 64 Seiten
aufgestockt. Einige wenige Bände waren auch Doppelbände, die aber trotzdem als eine Nummer erschienen.
Inhaltlich boten die meisten Utopia-Hefte ein buntes Sammelsurium von Romanen bescheidener Qualität. Bei den übersetzten Titeln
gab es allerdings einige wenige Titel, die Kurzserien angehörten. Darunter finden sich drei Storys von John W. Campbell,
die zusammen einen Episodenroman bilden, zwei Darkover-Romane von Marion Zimmer Bradley, ein Randwelten-Roman von A. Bertram Chandler,
ein James Retief-Titel von Keith Laumer, zwei Doc Savage-Titel von Kenneth Robeson und zwei Etagenwelt-Titel von Philip José Farmer.
Herausragend war auch Stanislaw Lems Klassiker Vorstoß zum Abendstern, der als Doppel- band erschien.
In der späteren Phase der Heftreihe wurden auch 25 Originalanthologien mit teilweise weit über das sonstige Niveau der Reihe
herausragenden Kurzgeschichten von der Redakteurin Lore Matthaey zusammengestellt.
Der überwiegende Teil der Romane deutschsprachiger Autoren waren entweder Erstveröffentlichungen oder Nachdrucke von Leihbüchern.
Darunter waren auch Romane der ZBV-Serie von K.H. Scheer, von Clark Darltons Hurricane und des Prokaskischen Krieges von W.W. Shols.
Über den Großteil der sonstigen Einzeltitel, seien sie deutschen oder fremdsprachigen Ursprungs, kann man getrost den Mantel des
Schweigens breiten. Insgesamt zeigt es sich, dass während der 15 Jahre, in denen die Utopia-Reihe erschien, Konzept und Aufmachung
mehrmals geändert wurden. Die später gestartete Konkurrenzreihe Terra des Moewig Verlags sollte sich
wesentlich größerer Kontinuität erfreuen.
Die Titelbilder wurden von unterschiedlichen Künstlern gestaltet. Dabei waren auch Bilder des später durch Perry Rhodan berühmt
werdenden Johnny Bruck, seines Kollegen Karl Stephan, der in den Utopia-Reihen meist unter seinem Pseudonym H. Albrecht signierte,
sowie einige Cover, die von amerikanischen Maga- zinen oder der italienischen Urania-Reihe übernommen wurden. Ab etwa Band 200
wurde dann Rudolf Sieber-Lonati der "Hauszeichner", der den Großteil der Titelbilder ablieferte. Lonati war aber kein typischer
SF-Zeichner, sondern betätigte sich auch im Krimi-, Western- und Gruselumfeld. In der Spätphase der Utopia-Reihe kam dann noch
Hans Möller dazu, der hauptsächlich die Titelbilder der Subserie Ad Astra anfertigte. |